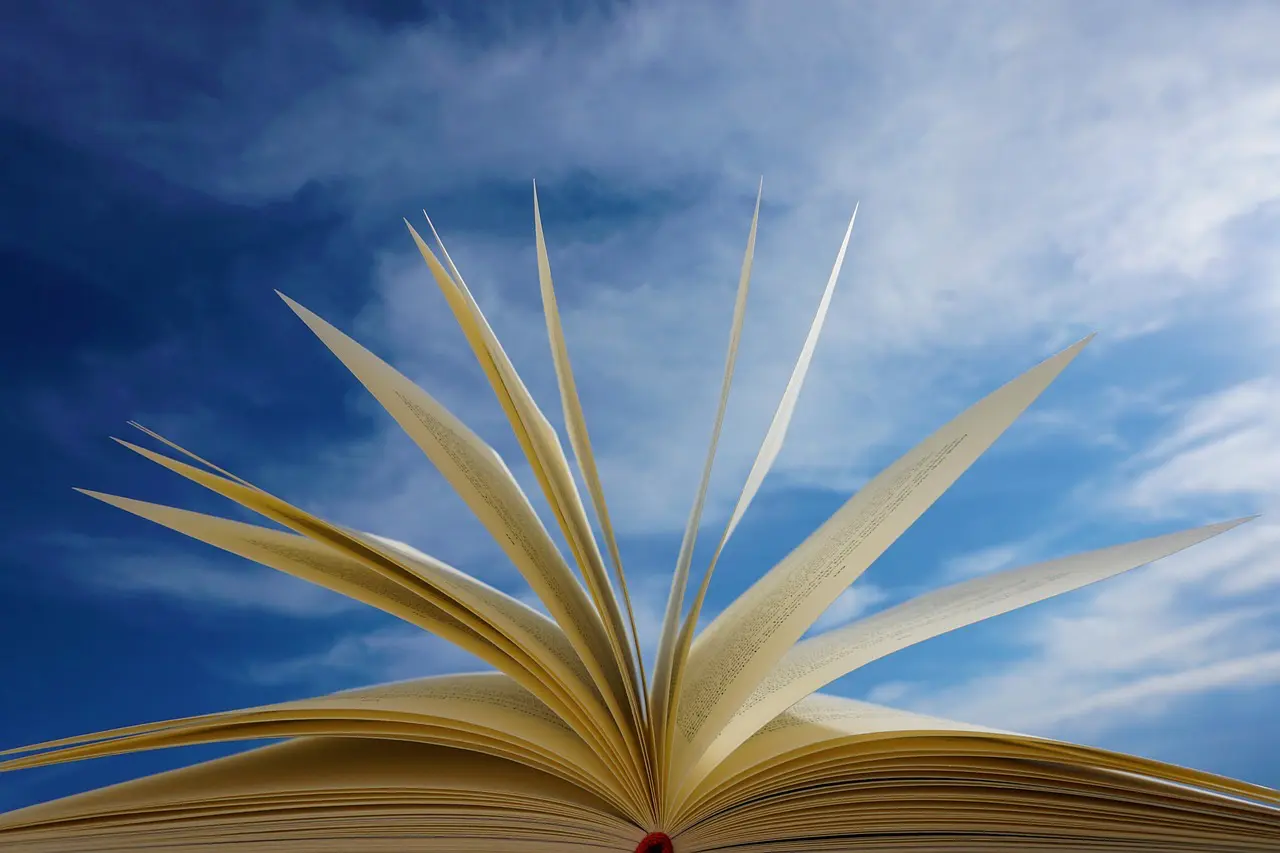
„Die Lernfähigkeit ist eine Angelegenheit der geistigen Haltung, nicht des Alters.“
Emil Oesch
Glossar
Im Glossar finden Sie kurze, verständliche Erläuterungen zentraler Begriffe aus Psychotherapie, Hypnosetherapie, Coaching, Paar- und Sexualtherapie. Die Inhalte richten sich an Klient:innen und Interessierte, die sich über Fachbegriffe informieren möchten.
I
Ich-Zustände
Das Eltern-Ich enthält Normen, Regeln und Haltungen, die von Bezugspersonen übernommen wurden. Es kann fürsorglich („beschützendes Eltern-Ich“) oder kritisch („kritisches Eltern-Ich“) sein. In der Transaktionsanalyse wird reflektiert, wann dieses Ich-Zustand hilfreich ist – und wann er unbewusst andere kontrolliert oder einschränkt.
Identitätsentwicklung
Identitätsentwicklung ist der lebenslange Prozess, in dem Menschen klären, wer sie sind, welche Werte sie vertreten und wie sie sich in Beziehung zu anderen erleben. Besonders in Umbruchphasen kann Identität instabil wirken. In der Therapie wird daran gearbeitet, Selbstbild, Lebensentwürfe und Zugehörigkeit bewusst zu gestalten.
Identitätsfindung
Identitätsfindung beschreibt den Prozess, in dem Menschen klären, wer sie sind, wofür sie stehen und was ihnen im Leben wichtig ist. Besonders in Umbruchphasen kann es zu Unsicherheit oder Orientierungslosigkeit kommen. In der Therapie geht es darum, ein stimmiges Selbstbild zu entwickeln und innere Anteile zu integrieren.
Identitätskonflikt
Ein Identitätskonflikt entsteht, wenn Menschen sich unsicher darüber sind, wer sie sind, wofür sie stehen oder wie sie leben möchten. Er tritt häufig in Übergangsphasen, bei belastenden Erfahrungen oder inneren Veränderungen auf. Die therapeutische Arbeit unterstützt darin, ein stimmiges Selbstbild zu entwickeln.
Innere Abwesenheit
Innere Abwesenheit ist ein Zustand, in dem man zwar äußerlich präsent ist, innerlich aber wie „weg“ oder nicht spürbar. Sie tritt häufig in Stress- oder Angstsituationen auf. In der Therapie geht es darum, Erdung, Selbstwahrnehmung und sichere Rückverbindung ins Hier und Jetzt zu ermöglichen.
Innere Alarmbereitschaft
Innere Alarmbereitschaft beschreibt einen dauerhaften Zustand erhöhter Wachsamkeit – meist unbewusst. Er zeigt sich z. B. durch Schreckhaftigkeit, Schlafprobleme oder Schwierigkeiten mit Entspannung. Dieser Zustand ist oft Folge von Trauma oder chronischem Stress. Therapie zielt auf Beruhigung des Nervensystems und das Erleben von Sicherheit.
Innere Alarmierung
Innere Alarmierung ist das Erleben plötzlicher innerer Gefahrenwahrnehmung – etwa durch Trigger, Konflikte oder emotionale Nähe. Sie führt zu Flucht-, Kampf- oder Erstarrungsreaktionen. In der Therapie geht es darum, diese Signale früh zu erkennen und das Nervensystem wieder in Sicherheit zu begleiten.
Innere Anspannung
Innere Anspannung ist ein dauerhaft erhöhter Spannungszustand, der sich psychisch und körperlich äußern kann – z. B. durch Unruhe, Muskelverspannung, Gereiztheit oder Konzentrationsprobleme. In der Therapie stehen Entlastung, Körperwahrnehmung und Techniken zur Spannungsregulation im Vordergrund.
Innere Anspannung trotz äußerer Ruhe
Obwohl im Außen kein Druck besteht, bleibt der Körper in Alarmbereitschaft: Muskelanspannung, Unruhe oder Gedankenkreisen sind anhaltend. Häufig ist das Nervensystem durch frühere Belastung dauerhaft in Habachtstellung. In der Therapie stehen Körperregulation, Sicherheit und Entlastung im Vordergrund.
Innere Anteile
Innere Anteile sind verschiedene Seiten der eigenen Persönlichkeit – etwa ein kritischer Anteil, ein verletztes inneres Kind oder ein beschützender Anteil. Sie können sich widersprechen oder ergänzen. In der Therapie geht es darum, diese Anteile kennenzulernen, zu verstehen und in Einklang zu bringen.
Innere Antriebslosigkeit
Dieses Gefühl beschreibt den Verlust der Verbindung zu den eigenen Wünschen, Impulsen oder Zielen. Betroffene funktionieren oft im Außen, ohne innere Ausrichtung. Die Therapie hilft dabei, wieder Zugang zu innerer Stimme, Lebensmotivation und persönlicher Ausrichtung zu finden.
Innere Arbeitsbündnisse
Bevor Paare in Beziehung etwas verändern können, braucht es oft eine innere Klärung: Welche Anteile in mir sind beteiligt? Was wünsche ich mir – und was macht mir Angst? In der traumasensiblen Paartherapie wird mit solchen inneren Bündnissen gearbeitet, um tragfähige äußere Beziehungsschritte vorzubereiten.
Innere Bezugspersonen
Innere Bezugspersonen sind stabilisierende innere Bilder von unterstützenden, zugewandten Menschen – real oder imaginiert. Sie können im therapeutischen Prozess aufgebaut werden, wenn äußere Bindungserfahrungen fehlen oder belastet sind. Sie stärken Sicherheit, Selbstberuhigung und emotionale Versorgung von verletzlichen Anteilen.
Innere Dialoge über die Partnerschaft
Was denke ich über uns? Was erzähle ich mir selbst, wenn wir streiten? Diese inneren Gespräche prägen, wie wir fühlen und handeln. In der Paartherapie wird erkundet, wie solche inneren Stimmen wirken – und wie sie bewusst verändert werden können.
Innere Erlaubnis zur Selbstfürsorge fehlt
Viele Menschen empfinden unbewusste innere Widerstände, sich um sich selbst zu kümmern – aus Schuldgefühlen, Leistungsdruck oder frühen Prägungen. Selbstfürsorge wird dann als „egoistisch“ empfunden. In der Therapie wird die Bedeutung von Selbstzuwendung gestärkt und mit hinderlichen Überzeugungen gearbeitet.
Innere Erschöpfung trotz Ruhephasen
Auch nach Ruhe oder Urlaub bleibt ein Gefühl von Erschöpfung bestehen – körperlich oder seelisch. Dies weist auf tiefer liegende Belastungen, Daueranspannung oder emotionale Erschöpfung hin. In der Therapie steht die Entlastung des Nervensystems, die Bearbeitung von Stressmustern und nachhaltige Erholung im Mittelpunkt.
Innere Fragmentierung
Innere Fragmentierung meint ein Erleben von Getrenntheit zwischen verschiedenen inneren Anteilen – z. B. zwischen dem Funktionieren im Alltag und einem verletzten inneren Kind. Sie tritt häufig nach Traumatisierungen auf. Therapeutisch geht es um achtsame Integration, Selbstbegegnung und das Erleben innerer Verbundenheit.
Innere Instabilität
Innere Instabilität äußert sich in stark schwankenden Gefühlen, unsicherem Selbstbild oder impulsivem Verhalten. Beziehungen, Entscheidungen oder Stimmungen können sich rasch verändern. Die Therapie bietet einen sicheren Rahmen, um emotionale Stabilität und innere Orientierung aufzubauen.
Innere Kündigung
Manche Menschen bleiben äußerlich in der Beziehung, haben sich innerlich aber bereits verabschiedet – oft aus Enttäuschung, Resignation oder langer Überforderung. In der Paartherapie wird dieser Zustand ernst genommen. Es geht darum, Klarheit zu gewinnen: Ist ein gemeinsamer Weg noch möglich?
Innere Leere
Innere Leere beschreibt das Empfinden von Sinnlosigkeit, emotionaler Abwesenheit oder Entfremdung von sich selbst. Sie tritt häufig bei Depressionen, Persönlichkeitsstörungen oder nach traumatischen Erfahrungen auf. In der Therapie wird daran gearbeitet, wieder Zugang zu Gefühlen, Bedürfnissen und Selbstverbindung herzustellen.
Innere Navigation
Innere Navigation bezeichnet die Fähigkeit, sich anhand von Gefühlen, Bedürfnissen und Körperwahrnehmungen im eigenen Leben zu orientieren. Sie entsteht durch Selbstanbindung und gelebte Selbstverantwortung. In der Therapie wird daran gearbeitet, diese innere Stimme wieder hörbar und vertrauenswürdig werden zu lassen.
Innere Orientierungslosigkeit
Innere Orientierungslosigkeit ist das Gefühl, nicht zu wissen, was richtig oder wichtig ist – weder im Denken noch im Fühlen oder Handeln. Sie tritt häufig in Umbruchphasen oder nach Krisen auf. Die therapeutische Begleitung hilft dabei, neue innere Klarheit, Werte und Entscheidungskompetenz zu entwickeln.
Innere Spannung
Innere Spannung ist ein Zustand erhöhter psychischer und körperlicher Anspannung, der sich nicht durch äußere Auslöser erklären lässt. Sie kann zu impulsivem Verhalten, Rückzug oder psychosomatischen Beschwerden führen. In der Therapie wird an der Wahrnehmung, Regulation und dem Ausdruck dieser Spannung gearbeitet.
Innere Starre
Innere Starre beschreibt das Gefühl, innerlich wie eingefroren zu sein – ohne Zugang zu Emotionen oder Impulsen. Sie ist oft Folge von Überforderung oder traumatischen Erfahrungen. In der Therapie geht es darum, vorsichtig wieder in Kontakt mit innerer Bewegung und Ausdruck zu kommen.
Innere Überwältigung
Innere Überwältigung bezeichnet das Gefühl, von inneren Impulsen, Emotionen oder Erinnerungen „überschwemmt“ zu werden – ohne diese kontrollieren zu können. In der Therapie wird mit Stabilisierung, Selbstwahrnehmung und Regulation gearbeitet, um Sicherheit im inneren Erleben zurückzugewinnen.
Innere Unentschlossenheit
Unentschlossenheit entsteht oft aus inneren Konflikten, der Angst vor Fehlern oder überhöhten Ansprüchen an die „richtige“ Entscheidung. Sie kann zu Lähmung oder Selbstzweifeln führen. In der Therapie wird an innerer Klarheit, Entscheidungsfähigkeit und Vertrauen in eigene Wege gearbeitet.
Innere Unruhe
Innere Unruhe beschreibt ein anhaltendes Gefühl von Getriebenheit, Anspannung oder Nervosität – oft ohne erkennbare Ursache. Sie kann mit Konzentrationsproblemen, Schlafstörungen oder körperlicher Anspannung einhergehen. In der Therapie wird an Beruhigung, Selbstwahrnehmung und regulierenden Strategien gearbeitet.
Innere Verhärtung
Innere Verhärtung beschreibt das Erleben von emotionaler Starre, Abwehr oder Rückzug – oft als Reaktion auf Enttäuschung, Dauerstress oder Verletzung. Gefühle wie Empathie oder Trauer sind dann schwer zugänglich. In der therapeutischen Arbeit geht es darum, diese Schutzmechanismen behutsam zu lockern und wieder in Kontakt zu kommen.
Innere Widersprüche
Innere Widersprüche entstehen, wenn zwei oder mehr Persönlichkeitsanteile unterschiedliche Ziele, Wünsche oder Bewertungen vertreten. Sie führen zu Entscheidungsblockaden oder innerer Spannung. In der Therapie werden diese Anteile differenziert wahrgenommen und miteinander in einen inneren Dialog gebracht.
Innere Widersprüchlichkeit
Innere Widersprüchlichkeit – etwa zwischen Wunsch nach Nähe und Angst vor ihr – ist oft kein Zeichen von Unentschlossenheit, sondern Ausdruck eines komplexen Schutzsystems. In der Therapie wird diese Widersprüchlichkeit ernst genommen und zur Grundlage für tiefere Selbstklärung und Integration gemacht.
Innere Zähigkeit
Innere Zähigkeit meint das Erleben, innerlich „festzustecken“, ohne Zugang zu Lebendigkeit, Gefühlen oder Veränderung zu finden. Häufig zeigt sie sich als emotionales oder gedankliches Wiederholen bekannter Muster. In der Therapie wird daran gearbeitet, Bewegung, Ausdruck und innere Flexibilität wieder zu ermöglichen.
Innere Zerrissenheit
Innere Zerrissenheit beschreibt einen Zustand, in dem widersprüchliche Gefühle, Gedanken oder Bedürfnisse gleichzeitig bestehen – ohne klare Orientierung. Das kann zu Entscheidungsblockaden oder innerer Unruhe führen. In der Psychotherapie wird daran gearbeitet, innere Anteile zu benennen und wieder in Einklang zu bringen.
Innerer Heilungsraum
Ein innerer Heilungsraum ist ein mentaler oder emotionaler Ort, der Sicherheit, Geborgenheit und Selbstzuwendung ermöglicht. Er wird in der Therapie z. B. durch Imagination, Körperwahrnehmung oder Achtsamkeit erfahrbar gemacht. Dieser Raum dient als Grundlage für Integration, Stabilisierung und die Begleitung verletzlicher innerer Zustände.
Innerer Konflikt
Ein innerer Konflikt entsteht, wenn unterschiedliche Wünsche, Überzeugungen oder Bedürfnisse miteinander in Widerspruch stehen – z. B. zwischen Anpassung und Autonomie. Solche Konflikte können lähmen oder dauerhaft belasten. In der Psychotherapie werden innere Spannungen bearbeitet und integrierbare Lösungen entwickelt.
Innerer Kritiker
Der innere Kritiker ist eine innere Stimme, die mit strengen, abwertenden oder kontrollierenden Kommentaren das eigene Verhalten bewertet. Er entsteht häufig aus internalisierten äußeren Anforderungen. In der therapeutischen Arbeit wird dieser Anteil bewusst gemacht, hinterfragt und durch konstruktivere innere Haltungen ersetzt.
Innerer sicherer Ort
Ein innerer sicherer Ort ist eine mentale Vorstellung, die Schutz, Ruhe und Geborgenheit vermittelt. Er wird häufig in der Therapie genutzt, um Stabilität und Selbstberuhigung zu ermöglichen – besonders bei Trauma, Angst oder Dissoziation. Der sichere Ort ist individuell und wird im inneren Erleben gestaltet.
Inneres „Funktionieren“ ohne innere Beteiligung
Manche Menschen erleben sich als funktionierend – sie erledigen Aufgaben, reagieren angemessen –, fühlen sich dabei aber innerlich leer, abgekoppelt oder nicht wirklich präsent. In der Therapie geht es darum, wieder Zugang zur eigenen Lebendigkeit, Echtheit und emotionalen Beteiligung zu schaffen.
Inneres Chaos
Inneres Chaos ist das Erleben von gedanklicher, emotionaler oder organisatorischer Überforderung – oft begleitet von Anspannung, Erschöpfung oder Kontrollverlust. Es entsteht häufig in Krisen oder bei zu vielen parallelen Anforderungen. Die therapeutische Arbeit hilft, innere Ordnung und Struktur schrittweise wiederherzustellen.
Inneres Drängen
Ein starkes Gefühl von innerem Druck, das nicht eindeutig einem Ziel oder Wunsch zugeordnet werden kann. Betroffene erleben Getriebenheit oder Rastlosigkeit, ohne zu wissen, wonach sie eigentlich streben. In der Therapie wird nach den zugrunde liegenden Bedürfnissen und unausgedrückten inneren Impulsen gesucht.
Inneres Kind
Das „innere Kind“ steht symbolisch für die kindlichen Anteile in uns – mit ihren Bedürfnissen, Ängsten und Verletzungen. In der Therapie wird über das innere Kind der Zugang zu frühen Erfahrungen ermöglicht. Ziel ist es, Kontakt zu Gefühlen aufzunehmen, alte Wunden zu versorgen und Selbstmitgefühl zu entwickeln.
Inneres Sich-Zurückhalten
Dieses Verhalten beschreibt ein bewusstes oder unbewusstes Anhalten von Impulsen, Meinungen oder Gefühlen – oft aus Angst, andere zu verletzen, sich zu blamieren oder zu viel zu sein. Die therapeutische Arbeit unterstützt darin, wieder Ausdruck, Mut und innere Erlaubnis zu entwickeln.
Integration abgespaltener Anteile
Abgespaltene Anteile entstehen häufig durch Überforderung oder Trauma – als innerpsychische Reaktion zum Schutz vor zu starken Gefühlen. Integration bedeutet, diese Anteile achtsam wahrzunehmen, zu verstehen und wieder in das Selbstbild zu integrieren. In der Therapie wird mit innerer Dialogarbeit und Stabilisierung gearbeitet.
Intimität
Intimität beschreibt das Erleben von Vertrautheit, Offenheit und Verbundenheit auf emotionaler, geistiger oder körperlicher Ebene. Sie setzt Sicherheit, emotionale Verfügbarkeit und wechselseitiges Interesse voraus. In der Therapie geht es oft um Blockaden, Ängste oder Konflikte, die Intimität erschweren.
Intimitätsangst
Intimitätsangst bezeichnet die Furcht vor emotionaler oder körperlicher Nähe, die oft mit einem Gefühl von Kontrollverlust oder Verletzlichkeit verbunden ist. Betroffene ziehen sich häufig zurück, obwohl sie sich Beziehung wünschen. In der therapeutischen Arbeit wird der Umgang mit Nähe und Sicherheit schrittweise erarbeitet.
Wählen Sie oben ein Zeichen aus der Leiste. Sie erhalten anschließend alle Glossarbegriffe, die mit diesem Zeichen beginnen – visuell übersichtlich dargestellt, leicht erfassbar und gut strukturiert.
